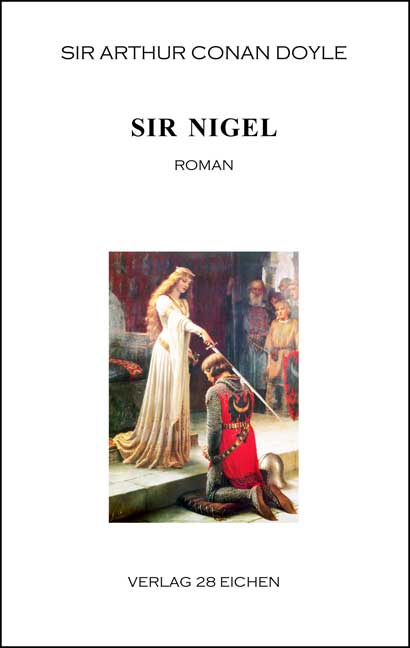|
Verlag 28 Eichen |
|
||||
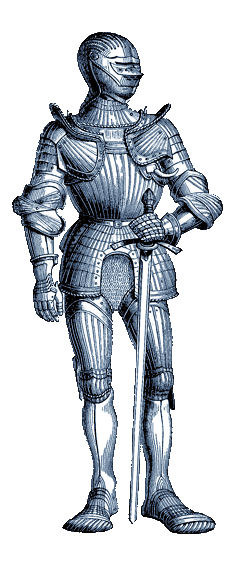 |
Der Fluß schlängelte sich gemächlich durch die Wiesen ins Tal hinab. An seinem Ufer stand eine Unmenge von Pferden. Das waren die Schlachtrösser der französischen Kavallerie, und der blaue Qualm von hundert Feuern zeigte, wo König Jeans Männer ihr Lager aufgeschlagen hatten. Vor dem Hügel, auf dem sie standen, hatten die Engländer ihr Lager aufgeschlagen, aber es brannten nur wenige Feuer, denn sie hatten kaum etwas zum Braten – außer ihren Pferden. Das Lager erstreckte sich vom Fluß über eine Meile bis zu einem undurchdringlichen Wald, der die Armee vor einem Angriff von der Seite schützte. Vor ihnen befand sich eine lange dichte Hecke und reichlich zerfurchter Boden, in der Mitte geteilt durch einen einzigen Trampelpfad. Unter der Hecke und entlang der Front lagen scharenweise Bogenschützen im Gras. Die meisten von ihnen schlummerten friedlich ausgestreckt in der warmen Septembersonne. Dahinter befanden sich die Quartiere der Ritter, und überall flatterten die Banner und Fanons mit den Wappen der Ritterschaft von England und Guienne. |
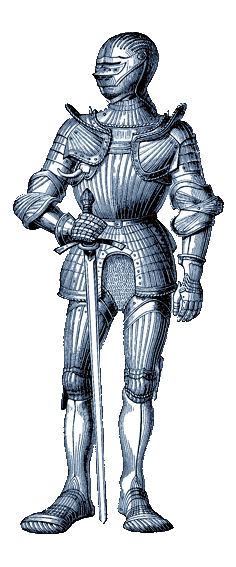 |
||
|
Helle Strahlen in finstere Zeit Niemand muß Conan Doyles Selbsteinschätzung teilen, wonach er, folgt man der Biografie Daniel Stashowers, diesen Roman und den eng mit ihm verflochtenen "The White Company" für seine literarisch besten Leistungen hielt. Anderseits kann man den Stolz eines Autors verstehen, der sich erfolgreich in eine nun allerdings fremde Zeit hineindenkt mit einem ritterlichen Moralkodex, der Verrat und List auch zwischen Gegnern unterbindet, im Gegenzug dann wieder unerbittlichen Grausamkeiten und himmelschreienden Absurditäten Tür und Tor öffnet. Das Buch ist innerhalb der Gattung, die es bedient, meisterhaft gebaut. Die bis zum bitteren Ende durchgehaltenen ritterlichen Grausamkeiten einiger Kapitel könnten diesbezüglich empfindsamere Leser abschrecken, es gelingt Doyle dessen ungeachtet jedoch, ein Feuerwerk leuchtender und sogar heiterer Farben in die Landschaft und das gesellschaftliche Leben des 14. Jahrhunderts zu schicken. Die Geschichte endet für die Hauptpersonen glücklich. Man kann selbstredend kaum beurteilen, inwieweit das vermittelte Bild der Historie entspricht, das Buch unterscheidet sich aber entschieden von historischen Romanen, die offenkundig heutige Menschen mit den Stoffen früherer Jahrhunderte drapieren. Für Doyle äußerst typisch sind komplexe Ablaufsschilderungen - im vorliegenden Fall (blutig ausgetragene Freundschafts-)Turniere (um der Tatenlosigkeit eines Waffenstillstands zu entgehen), Erstürmung einer Burg, Aufeinanderprallen gegnerischer Heere - die gegliedert und aufgebaut sind wie ein Krimi und soghafte Lesespannung erzeugen. Ebenso typisch ist aber auch die Ambivalenz, die Doyle entwickelt und die vermutlich seine eigene war: große Faszination vom Mut, der Geschicklichkeit und Disziplin ritterlicher Menschen und dem Planungsvermögen herausragender Strategen, Erfassen der Absurdität und mörderischen Stumpfsinnigkeit kriegerischer Schlächtereien auf der anderen Seite. Die schwer auf dem Körper lastende, schwerbewegliche Ritterrüstung wird an mehr als einer Stelle zum Symbol für eine absurde Zeitepoche. Aber glauben die meisten Zeitgenossen im Westen heute nicht auch, mithilfe von Technik die Natur zu überlisten, ja, noch absurder: sie weit darüber hinausgehend zu "verbessern"? Und machen sie unter der Last der Apparaturen nicht ebenso schlapp wie die Ritter, die nach einigen Stunden Kampftätigkeit den bewaffneten Arm nicht mehr heben konnten oder erschöpft vom Pferd stürzten, wenn sie denn nicht vorher schon einem grausamen Anschlag erlegen waren? Es hieße vielleicht den Bogen überspannen, dem Roman solche Symbolik zu unterstellen. Die symbolische Lesart greift vielleicht besser bei Doyles Challenger-Romanen, dem Geiseldrama "Ein gefährlicher Ausflug" oder der Parabel "Mr. Ruffles Haw". Dennoch lohnt auch "Sir Nigel" in der soliden Neuübersetzung von Nadine Erler einen zweiten Blick. Klauspeter Bungert Quelle: https://www.amazon.de/review/R1Q7U3GQ7CIZUR/ref=pe_1604851_57868791_cm_rv_eml_rv0_rv
|
||||